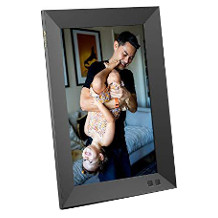Blitzgerät Kaufberatung: So wählen Sie das richtige Produkt
- Das Wichtigste in Kürze
- Externe Blitzgeräte gleichen schlechte Lichtverhältnisse besser aus als interne Blitze.
- Mehrere Kontaktstellen zwischen Kamera und Blitzgerät ermöglichen eine automatische Bedienung.
- Mit entfesselten Blitzgeräten ist eine vielfältige Lichtgestaltung möglich.
- Die Leitzahl gibt Auskunft über die Blitzleistung bei bestimmten Brennweiten, Blendeneinstellungen und ISO-Werten.
- Blitzgeräte bekannter Kamerahersteller sind oft nur mit den eigenen Produkten kompatibel.

Zugunsten einer optimalen Ausleuchtung
Kamerablitze haben einen schlechten Ruf: Der berüchtigte Rote-Augen-Effekt hat schon so manch einen Schnappschuss ruiniert. Dabei sind Blitze ein unverzichtbares Mittel, um die Lichtverhältnisse im Bild zu optimieren. Bei zu wenig Umgebungslicht helfen Blende, Belichtungszeit und ISO nur bedingt. Blitzgeräte können das Bild nicht nur aufhellen, sondern ihm auch mehr Tiefe verleihen. Voraussetzung ist, dass sie genügend Leistung haben und richtig eingesetzt werden.
Die meisten Kameras haben einen eingebauten Blitz. Da sie klein und leistungsschwach sind, ist die Effektivität dieser Blitze aber begrenzt. Mehr Gestaltungsspielraum hat man mit größeren externen Blitzgeräten. Sie ermöglichen es FotografInnen, die Lichtverhältnisse kreativ zu gestalten, etwa indem sie an bestimmten Stellen absichtlich harte Schatten setzen. Bei Bedarf lassen sich sogar mehrere externe Blitzgeräte verbinden und frei um das Motiv herum positionieren.
Blitzgeräte sind ideal für Aufnahmen im Studio, können aber auch bei starkem Sonnenlicht dabei helfen, harte Schatten zu reduzieren. Für EinsteigerInnen in die Blitzfotografie sind klassische Aufsteckblitze am besten geeignet.
Bei Aufsteckblitzen handelt es sich um relativ kompakt gebaute Blitzgeräte, die sich am Blitzschuh der Kamera befestigen lassen. Sie sind auch als Systemblitze bekannt und werden per Akku betrieben. Am Blitzschuh und am Gerät befinden sich Kontakte, die die Kommunikation mit der Kamera ermöglichen

Weitere externe Blitzgeräte
Für den professionellen Einsatz gibt es sogenannte Studioblitze. Studioblitze sind nicht nur leistungsstärker als Systemblitze, sondern auch für den Dauereinsatz ausgelegt. Sie erhalten den nötigen Strom per Netzkabel. Des Weiteren sind sie auf die Nutzung mit Lichtformern wie Softboxen, Reflektoren und Spots spezialisiert.
Der Einsatz von klassischen Aufsteck- und Studioblitzen führt bei Nah- und Makroaufnahmen oft zu unerwünschten Schatten. Für diese Einsatzgebiete gibt es daher spezielle Makroblitze. Aufgrund ihrer Bauweise werden sie auch als Ringblitze genannt. Sie bestehen aus ringförmig angeordneten Blitzröhren und einer Halterung. Die Positionierung erfolgt vor dem Objektiv. Die Elektronik mit Auslösemechanik befindet sich auf dem Zubehörschuh und ist meist über ein Spiralkabel mit den Blitzröhren verbunden. Ringblitze schaffen eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung bei geringen Motivabständen.
Darauf kommt es beim Kauf an
Fotografie ist ein weites Feld mit zahlreichen Ausprägungen und Einsatzmöglichkeiten. Der ideale Blitz hängt davon ab, für welche Bereiche er gedacht ist. Da klassische Aufsteckblitze nicht für EinsteigerInnen in die Blitzfotografie am besten geeignet, sondern auch vielfältig einsetzbar sind, liegt der Fokus darauf.
Manuelle oder automatische Einstellung?
Blitzgeräte lassen sich entweder manuell oder mithilfe der TTL-Technik (through the lens) bedienen.
Einfache Blitzgeräte verfügen nur über einen Mittenkontakt, der das Auslösen des Blitzes ermöglicht: Der Blitz belichtet den Sensor, sobald der Verschluss komplett geöffnet ist. Die Bedienung erfolgt ausschließlich manuell. Kamera und Blitzgerät tauschen keine Daten aus und spezielle Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten gibt es nicht.

Blitzgeräten mit mehreren Kontakten ist der Einsatz von TTL möglich. Blitzgerät und Kamera tauschen Daten wie
- die Brennweite,
- den Motivabstand,
- die Blendeneinstellung,
- die Verschlusszeit und
- den ISO-Wert
aus, um die Helligkeit und die optimale Blitzlichtmenge zu ermitteln. Die Berechnung dauert nur wenige Mikrosekunden. Somit ist das TTL-Blitzen ideal, wenn Sie oder die Motive sich bewegen und Sie keine Zeit für Testaufnahmen haben. Bei Bedarf lassen sich TTL-Blitze auch manuell nutzen.
Beim manuelle Blitzen können FotografInnen weder die Intensität noch die Dauer des Blitzes kontrollieren, sondern nur die Blitzstärke am Gerät oder an der Kamera einstellen, also zum Beispiel die Hälfte oder ein Viertel der Maximalleistung. Durch die Anpassung des Blenden- und ISO-Werts an der Kamera sowie der Abstand des Blitzes zum Motiv lässt sich die Belichtung zusätzlich justieren.
Manuelle Blitze eignen sich für mehrere Aufnahmen vom selben Motiv, bei denen sich Abstand und Belichtungseinstellungen nur geringfügig ändern. Das ist beispielweise bei der Lebensmittel- und Produktfotografie der Fall. Da FotografInnen das gesamte Set-up inklusive der Stärke des Blitzes selbst ermitteln müssen, dauert es länger, bis die ersten brauchbaren Aufnahmen erfolgen. Manuelle Blitze sind daher am besten für Anwendungen, bei denen sich die Szene in Ruhe einrichten lässt.
Weitere Funktionen
Wenn Sie einen TTL-Aufsteckblitz auf die Kamera montieren, passt sich der Lichtkegel an den Erfassungswinkel des Objektivs an, sodass der gesamte Bildausschnitt beleuchtet ist. Bei Blitzgeräten mit Zoom-Funktion lässt sich der Lichtkegel unabhängig vom Objektiv verändern. Wer eine höhere Brennweite am Blitz einstellt, sorgt dafür, dass er nicht den gesamten Bildausschnitt beleuchtet. Ist die Brennweite geringer als die Objektiv-Brennweite, wird mehr als nötig ausgeleuchtet. Zwar verschwenden Sie beim direkten Blitzen Leistung, beim indirekten Blitzen an eine Wand ist es aber möglich, weicheres Licht zu erzeugen. Um indirektes Blitzen zu erleichtern, ist ein dreh- und schwenkbares Blitzgerät sehr praktisch: Es lässt sich mühelos auf zur Wand oder Decke richten.

Besonderen Funktionen wie die High-Speed-Synchronisation (HSS) beziehungsweise die Kurzzeitsynchronisation sind nur mit TTL-fähigen Geräten nutzbar. Dieses Feature sorgt für Verschlusszeiten, die kürzer als die Blitzsynchronisationszeit sind. Anstatt einmalig zu leuchten, pulsiert der Blitz mehrmals hintereinander. Die maximale Reichweichte ist aber geringer, da das Gerät nicht genügend Zeit zum vollständigen Aufladen hat. HSS eignet sich besonders für Sportaufnahmen und Action-Bildern.
Die Blitze entfesseln
Montieren Sie einen Aufsteckblitz auf den Blitzschuh, fesseln Sie diesen an die Oberseite der Kamera. Das Motiv lässt sich nur frontal beleuchten. Um aus einer anderen Richtung zu blitzen, ist es nötig, das Gerät unabhängig von der Kamera positionieren zu können. Dieses Entfesseln ist durch drei Methoden realisierbar: per Kabel, Licht oder Funk.

Entfesseln per Kabel
Am einfachsten gelingt das Entfesseln mit einem speziellen Kabel, das auf der einen Seite einen Fuß für den Blitzschuh und auf der anderen Seite einen passenden Schuh für den Blitz besitzt. Somit werden die Kontakte direkt miteinander verbunden. Je länger das Kabel, desto freier die Lichtgestaltung. Sowohl Hersteller als auch Drittanbieter stellen die Kabel zur Verfügung. Allerdings eignet sich die Methode nur für einen einzigen Blitz.

Entfesseln per Licht
Beim Entfesseln per Licht steuert ein Hauptblitz mehrere untergeordnete Blitze in einem System. Der Hauptblitz ist per Kabel oder Blitzschuh mit der Kamera verbunden, während die abhängigen Blitze um das Motiv positioniert sind. Über das Kameramenü lassen sich bei einigen Systemen beliebig viele untergeordneten Blitze in zwei bis drei Gruppen aufteilen. Die Methode ist jedoch bei Sonnenlicht nur bedingt nutzbar. Zudem ist Sichtkontakt zwischen Haupt- und Nebenblitzen erforderlich.

Entfesseln per Funk
Beim Entfesseln per Funk besteht die Wahl zwischen Systemblitzen mit integrierter Funkeinheit und externen Funksystemen. Für die erste Variante müssen alle Blitze eine solche Funkeinheit besitzen. Externe Funksysteme bestehen aus einem Sender zum Montieren am Blitzschuh sowie Empfänger für die Blitze. Während bei einfachen Systemen alle Blitze gleichzeitig auslösen, können hochwertige Versionen auch Blitzgruppen definieren. Die Blitze arbeiten auch bei Tageslicht und ohne Sichtverbindung mit der Kamera.
Leitzahl und Blitzleistung
Mit der sogenannten Leitzahl ist es möglich, die maximale Reichweite zu ermitteln, in der das Blitzgerät das Fotoobjekt optimal ausleuchtet. Je höher die Reichweite, desto leistungsstärker das Blitzgerät. Die errechnete Leitzahl bei Blitzgeräten bezieht sich in der Regel auf die Blendeneinstellung f/1.
Die Reichweite ermitteln
Um die Reichweite beziehungsweise den Abstand A zu ermitteln, ist es nötig, die Leitzahl L durch die Blende B zu teilen, mit der Sie das Motiv aufnehmen möchten.
Ein Beispiel:
A = 56/5,6
A = 10
Bei einer Leitzahl von 56 und einer Blendeneinstellung von F/5,6 können Sie ein bis zu zehn Meter entferntes Objekt beleuchten.
Bei der Berechnung der Leitzahl nehmen sowohl der ISO-Wert als auch der Leuchtwinkel Einfluss. Bevor Blitzgeräte mit Zoomfunktion auf den Markt kamen, gaben die meisten Hersteller die Leitzahl bei einem ISO-Wert von 100 und einem Leuchtwinkel von 35 Millimetern an. Mittlerweile weichen viele Hersteller von diesen Richtwerten ab, um eine bessere Blitzleistung zu implizieren als tatsächlich vorhanden. Sie nutzen etwa einem Leuchtwinkel von 100 Millimetern, geben diesen Wert aber nicht an. Oder sie erhöhen den ISO-Wert von 100 auf 200.
Den ISO-Wert um eine Stufe zu erhöhen, hat den gleichen Effekt wie die Blende um eine Stufe zu öffnen. Da bedeutet für die Berechnung der Reichweite, dass die gewählte Blendeneinstellung um eine Stufe verändert wird. Aus 56 / 5,6 wird dann 56 / 4, wodurch die Reichweite von 10 auf 14 Meter steigt. Wenn Sie bei der Produktbeschreibung feststellen, dass der Hersteller die Leitzahl für ISO 200 ermittelt hat, können Sie den Wert durch die Quadratwurzel von zwei teilen.
Die Leitzahl und der Leuchtwinkel
Der Einfluss, den der Leuchtwinkel beziehungsweise die Objektivbrennweite auf die Leitzahl hat, lässt sich einfach erklären: Der Blitz beleuchtet nur den Teil des Fotoobjekts, den der Bildwinkel der Brennweite vorgibt. Bei einem Weitwinkelobjektiv muss sich das Blitzlicht in einem weiteren Winkel streuen, um den gesamten Bildausschnitt zu beleuchten, als bei einem Teleobjektiv.
- Je kleiner die Millimeterangabe, desto größer der Bildausschnitt und desto geringer die Reichweite des Blitzlichtes.
- Je größer die Angabe ist, desto weniger Fläche muss der Blitz erhellen, sodass das gebündelte Licht weiter reicht.
Wer die Leitzahlen zweier Blitze vergleichen will, die sich auf die gleiche ISO, aber unterschiedliche Brennweiten beziehen, kann die Angaben nicht so leicht umrechnen wie bei verschiedenen ISO-Werten. Es empfiehlt sich ein Blick in die Gebrauchsanleitung der beiden Produkte. Dort findet sich oft eine hilfreiche Tabelle mit den Leitzahlen für unterschiedliche Objektivbrennweiten.
Welche Leistung ist nötig?
Wie leistungsstark das Blitzgerät sein soll, hängt unter anderem vom Einsatzbereich und von den vorhandenen Objektiven ab. Portrait- oder Produktfotos zum Beispiel entstehen meist nicht aus größeren Entfernungen. Daher muss auch der Blitz keine enorme Reichweite haben. Um hingegen große und weite Räume oder Events aufzunehmen, ist ein starker Blitz sinnvoll. Je größer der maximale Aufnahmebereich ist, den Sie belichten möchten, desto leistungsstarker sollte das Gerät sein.
Zum Aufnahmebereich zählt nicht nur die Distanz zum Objekt, sondern auch der Bildausschnitt, weshalb die Objektivbrennweiten auch relevant sind. Je enger der Bildausschnitt ist, desto fokussierter strahlt das Blitzlicht auf das Motiv. Wer also sowohl naheliegende als auf entfernte oder weitläufige Motive ablichten möchte, wählt ein Gerät, dessen Reichweite für Letzteres geeignet ist. Selbst wer vorwiegend Nahaufnahmen macht, kann problemlos eine höhere Leistungsklasse als nötig wählen, da schnelleres Nachladen möglich ist, wenn der Blitz nicht bei Maximalleistung arbeiten muss.
Kompatibilität
Der Name Systemblitz resultiert daraus, dass viele Geräte nur mit den Kameras derselben Marke kompatibel sind: Ein Canon-Blitz ist für Canon-Kameras und ein Sony-Blitz für Sony-Kameras gedacht. Bei Drittanbietern ist die Kompatibilität geräteabhängig. Solange der Mittenkontakt vom Blitzschuh und vom Gerät übereinstimmt, kann der Blitz auslösen. Wenn der Mittenkontakt passt, aber die Kontakte für die TTL-Automatik nicht überstimmen, ist nur eine manuelle Bedienung möglich. Um die volle Funktionsbreite der Blitzgeräte nutzen zu können, ist es daher besonders wichtig, vor dem Kauf die Kontakte miteinander abzugleichen. Zudem sind in der Regel nur Funkauslöser und Bitze desselben Systems kompatibel.

Des Weiteren sollte das Größenverhältnis zwischen Kamera und Blitz übereinstimmen. Ein großer Blitz auf einer kleinen spiegellosen Systemkamera erschwert die Handhabung, da der Schwerpunkt zu weit oben liegt.
Praktisches Hilfsmittel zur Lichtgestaltung
Das direkte Blitzen auf ein Motiv erzielt nicht immer die besten Ergebnisse: Zu starkes Licht verursacht harte Schatten oder überstrahlt das Bild, eine zu niedrige Leistung beleuchtet nur unzureichend. Mit den richtigen Lichtformern ist es nicht nur möglich, das Blitzlicht weicher zu gestalten, sondern es auch zu lenken. Klassische Mittel, um Licht weicher zu machen, sind Diffusor, Softboxen und Blitzschirme.
Bei einem Diffusor handelt es sich um einen becherähnlichen Aufsatz, der über den Blitz kommt. Dieser streut das Licht, sodass es sich flächiger auf dem Motiv verteilt. Den besten Effekt mit einem Diffusor erzielen Sie, wenn das gestreute Licht durch andere Oberflächen reflektiert wird.
Durchlichtschirme werden vor Studio- oder entfesselten Blitzen platziert. Sie verteilen das Licht breitflächig über das gesamte Motiv. Fangen Sie das durch den Diffusor gestreute Licht mit einem Schirm auf, ist noch weicheres Licht realisierbar.
Softboxen sind das wirkungsvollste Mittel, um harte Linien sowie unerwünschte Schatten zu reduzieren und gleichmäßige Übergänge zu schaffen. Mittlerweile gibt es auch kompakte und faltbare Softboxen, die sich für Systemblitze eignen. Kompakte Softboxen, auch Microboxen genannt, werden mithilfe eines Klettstreifens vor dem Blitzgerät platziert. Für Falt-Softboxen hingegen gibt es Blitzhalterungen mit einem Anschluss für Lichtformer. Der De-facto-Standard dafür ist der sogenannte Bowens-Mount.
In einigen Fällen passen die Farbtemperaturen von Blitz- und Umgebungslicht nicht zusammen: Der Blitz liefert zum Beispiel kühles Licht, aber Sie möchten ein Bild bei Kerzenlicht aufnehmen. Hier stört das Blitzlicht die gesamte Atmosphäre. Eine einfache Lösung sind verschiedene Farbfolien oder farbige Filterscheiben, die sich vor dem Reflektor des Blitzgeräts positionieren lassen. Gelb hilft zum Beispiel, um den Blitz an warme Lichtquellen anzugleichen. Darüber hinaus lassen sich die Folien zur Lichtgestaltung nutzen. Ein blau leuchtender Raum ist typisch bei Gaming-Bildern.

Weiterführende Testberichte
Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Vergleich. Wir haben die Blitzgeräte nicht selbst getestet.
Zwar haben weder die Stiftung Warentest noch ÖKO–TEST Blitzgeräte getestet, dafür übernahmen zahlreiche Fachmagazine zum Thema Fotografie diese Aufgabe. Sie führen sowohl Einzeltests als auch Vergleichstests durch. Im Jahr 2021 überprüften zum Beispiel die RedakteurInnen von FOTOHITS den Aufsteckblitz EF-60 von Fujifilm. Das Produkt überzeugte mit einer hervorragenden Lichtleistung und einer zuverlässigen TTL-Steuerung. Allerdings wirkte das Rändel-Einstellrad beim Bedienen nicht sehr robust.
Einige Jahre zuvor, 2017, testete der Redakteur Harm-Diercks Gronewold von digitalkamera.de den Metz mecablitz M400. Das Gerät überzeugte mit einem einfachen Bedienkonzept und kompakten Abmessungen. Dem Testredakteur zufolge ist es hervorragend für kleine Spiegelreflex- und spiegellose Systemkameras geeignet. Zudem ist der mecablitz mit den Blitzschuhen von Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Fujifilm und Pentax kompatibel.
Viele Testberichte stehen nicht kostenfrei zur Verfügung. VerbraucherInnen müssen das dazugehörige Fachmagazin direkt kaufen. Auf diversen Fotografie-Seiten und Blogs, die Tipps und Tricks zur Blitzlichtfotografie zur Verfügung stellen, finden VerbraucherInnen häufig Informationen zu guten Blitzgeräten und Set-ups.
Der Fotograf Moritz Faehse hat zum Beispiel im Jahr 2020 einen Systemblitz von Jinbei getestet, den HD-2 Pro, und diesen mit dem Godox V1 sowie dem Profoto A1x beziehungsweise A10 verglichen. Der HD-2 Pro punktete vor allem mit einer einfachen Bedienung, schnellen Bildfolgen und einer langen Akkulaufzeit. Darüber hinaus sorgte das Gerät für eine konstante Belichtung. Im Vergleich zum Godox-Modell überhitze es nicht. Profoto-Blitze sind zuverlässig und robust, aber weitaus teuer als Jinbei-Produkte.
Abb. 1–9: © Netzvergleich


 2.575 Bewertungen
2.575 Bewertungen